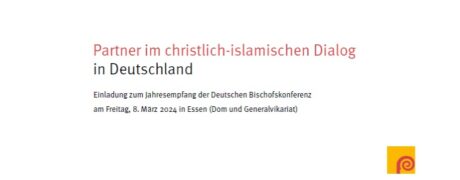Empfang für die Partner im christlich-islamischen Dialog 2024
28. Februar 2024
Comments are off
Einladung für Medienvertreter Die Deutsche Bischofskonferenz lädt zum fünften Mal ihre Partner im christlich-islamischen Dialog zu einem Jahresempfang ein. Dieser Austausch macht Jahr für Jahr das geschwisterliche Miteinander von Christen und Muslimen in Deutschland deutlich. Die Koll
Weiterlesen →Weltkirchebischof Meier würdigt Dialog mit Islam in Indonesien
19. April 2023
Comments are off
Weltkirchebischof Bertram Meier will sich in Indonesien gemeinsam mit anderen Bischöfen für die Fortführung und Vertiefung des Dialogs vor allem mit dem Islam einsetzen. Auch habe er das Konzept "Pancasila" im Land gewürdigt, das Respekt vor den Religionen und der Religionen untereina
Weiterlesen →Kardinal: Krieg eint Religionen in Zentralafrika
18. April 2023
Comments are off
Der anhaltende Bürgerkrieg in der Zentralafrikanischen Republik hat nach Einschätzung von Kardinal Dieudonne Nzapalainga die Religionen des Landes näher zueinander gebracht.
Weiterlesen →Erzbistum Köln: Multireligiöse Schulfeier ist kein Gottesdienst
06. Februar 2023
Comments are off
Köln (KNA) Multireligiöse Feiern an den katholischen Schulen im Erzbistum Köln müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Das geht aus einer von Kardinal Rainer Maria Woelki unterzeichneten Richtlinie im aktuellen Amtsblatt der Erzdiözese hervor. So müsse ein besonderer Anlass gegeben
Weiterlesen →Islam-Experte: al-Tayyebs Umarmung mit dem Papst ist Ermutigung
07. November 2022
Comments are off
Die Papstreise nach Bahrain war aus muslimischer Sicht in vielerlei Hinsicht ein „historisches Ereignis“. Der katholische Theologe und Islam-Experte Timo Güzelmansur sieht in dem zweiten Besuch von Franziskus auf der arabischen Halbinsel mehrere Aspekte, die den weiteren Verlauf des c
Weiterlesen →Islamexperte sieht Papst-Reise nach Bahrain als Erfolg “Es sollte nicht nur bei guten Worten bleiben”
07. November 2022
Comments are off
Papst Franziskus hat auf seiner Reise in Bahrain viele wertvolle Impulse für das Zusammenleben unterschiedlicher Religionen gegeben. Islamexperte Timo Güzelmansur sieht dadurch Fortschritte im interreligiösen Dialog. DOMRADIO.DE: Was war der Grund für die Papst Reise nach Bahrain? Dr.
Weiterlesen →Erklärung des Runden Tisches der Religionen in Deutschland zum „Tag der Religionen in Potsdam“ am 25. Oktober 2022
25. Oktober 2022
Comments are off
Klimawandel – eine Herausforderung auch an die Religionen! Die aktuelle Weltlage lässt keinen Zweifel mehr daran, dass die Beherrschung des Klimawandels eine der größten Herausforderungen der gegenwärtigen Menschheit ist. Während längst Einvernehmen darüber besteht, dass nur gemeinsam
Weiterlesen →Offizielle Eröffnung der Vatikanbotschaft in Abu Dhabi
07. Februar 2022
Comments are off
Vatikanstadt/Abu Dhabi (KNA) Am Internationalen Tag der Geschwisterlichkeit hat der Vatikan eine neue Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eröffnet. Die Einweihung am Freitag sei ein Beweis für die guten bilateralen Beziehungen zwischen den Emiraten und dem Heiligen
Weiterlesen →Aiman Mazyek bewegt und “verdattert” nach Papstaudienz
18. Januar 2022
Comments are off
Köln (KNA) Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Aiman Mazyek, hat ein Treffen mit Papst Franziskus in dieser Woche als sehr bewegend und inspirierend beschrieben: “Als er zum Abschied sagte ‘Bete für mich’, hat mich das doch schon erwischt. Da
Weiterlesen →Zentralrat der Muslime besucht Papstaudienz
14. Januar 2022
Comments are off
Vatikanstadt/Berlin (KNA) Mitglieder des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) haben am Mittwoch im Rahmen einer Generalaudienz Papst Franziskus getroffen. “Es war uns eine Freude mit unseren christlichen Glaubensgeschwistern einmal mehr für den Zusammenhalt innerhalb der
Weiterlesen →Telefon: +49 69 726491 // E-Mail:
info [at] cibedo [punkt] de
Copyright © 2020 Christlich-Islamischer Dialog - CIBEDO e. V. Alle Rechte vorbehalten.