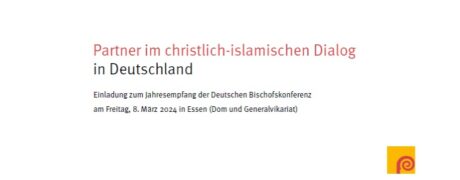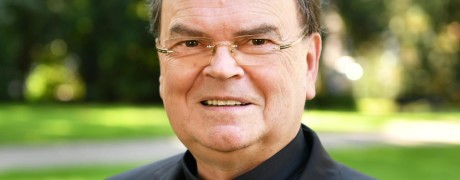Grußbotschaft des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, zum muslimischen Fastenmonat Ramadan 2024
10. März 2024
Comments are off
Der Friede sei mit Ihnen! Liebe muslimische Gläubige, zum diesjährigen Ramadan und zum Fest des Fastenbrechens sende ich Ihnen im Namen der Deutschen Bischofskonferenz und der katholischen Gläubigen in unserem Land herzliche Segenswünsche. 30 Tage lang üben Sie sich darin, durch Verzi
Weiterlesen →Empfang der Deutschen Bischofskonferenz für die Partner im christlich-islamischen Dialog
08. März 2024
Comments are off
„Keine Gerechtigkeit ohne Geschlechtergerechtigkeit“ Auf Einladung der Deutschen Bischofskonferenz hat heute (8. März 2024) in Essen zum fünften Mal der Jahresempfang für die Partner im christlich-islamischen Dialog stattgefunden. Aus Anlass des Internationalen Frauentags stand dabei
Weiterlesen →Papst verurteilt Anschläge in Burkina Faso “Hass keine Lösung”
07. März 2024
Comments are off
In Burkina Faso sind 15 Menschen bei einem Angriff auf eine katholische Kirche gestorben. Am selben Tag gab es einen Anschlag auf eine Moschee mit mehreren Dutzend Toten. Papst Franziskus äußert sich betroffen. Vatikanstadt (KNA) Papst Franziskus hat sich betroffen über die Terroransc
Weiterlesen →Herwig Gössl als Erzbischof von Bamberg eingeführt
04. März 2024
Comments are off
„In den Dienst an der Einheit will ich mich stellen“ Gut 16 Monate musste das Erzbistum Bamberg auf einen neuen Erzbischof warten, nun ist Herwig Gössl im Amt. Im Einführungsgottesdienst gab es Ermutigungen, eine Weltpremiere – und ein großes Glas voller Gummibärchen. Von Hannah
Weiterlesen →Empfang für die Partner im christlich-islamischen Dialog 2024
28. Februar 2024
Comments are off
Einladung für Medienvertreter Die Deutsche Bischofskonferenz lädt zum fünften Mal ihre Partner im christlich-islamischen Dialog zu einem Jahresempfang ein. Dieser Austausch macht Jahr für Jahr das geschwisterliche Miteinander von Christen und Muslimen in Deutschland deutlich. Die Koll
Weiterlesen →Entsetzen über Terror-Tote in Burkina Faso
26. Februar 2024
Comments are off
Zwei tödliche Anschläge auf Gotteshäuser in Burkina Faso mit Dutzenden Toten: Ganze Länder in der Region drohten von Gewalt zersetzt und das soziale Gefüge zerstört zu werden, warnt der deutsche Weltkirche-Bischof Meier. Von Alexander Brüggemann und Joachim Heinz (KNA) Bonn/Ouagadougo
Weiterlesen →Bischöfe: Völkischer Nationalismus und Christentum unvereinbar
23. Februar 2024
Comments are off
Die Brandmauer steht: Die katholischen Bischöfe haben eine klare Abgrenzung von der AfD gefordert und völkisches Gedankengut verurteilt. Augsburg (KNA) Rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien, die gegen Migranten, Muslime oder Juden hetzen, sind nach Auffassung der katholischen
Weiterlesen →Studiengang Islam und christlich-muslimische Begegnung
20. Februar 2024
Comments are off
Haben Sie Interesse an einer seriösen Einblick in den islamischen Glauben? Möchten Sie gerne wissen, wie der Koran zu verstehen ist, in welcher Zeit er entstanden ist und was in ihm steht? Die hybride Veranstaltung macht mit dem Koran vertraut – mit „Gottes dramatischen Monolog“
Weiterlesen →Papst eröffnet Fastenzeit mit Gedanken über das Wesentliche
15. Februar 2024
Comments are off
Die Fastenzeit hat Papst Franziskus in der schlichten Kirche Santa Sabina in Rom eingeleitet. Zum Auftakt der 40-tägigen Bußzeit warnte er vor einem Vordringen sozialer Medien ins Innerste der menschlichen Existenz. Rom (KNA) Mit einem Gottesdienst in der altchristlichen Basilika Sant
Weiterlesen →Bischof Bertram Meier zum Tag der Geschwisterlichkeit
05. Februar 2024
Comments are off
Logik von Terror und Krieg überwinden Aus Anlass des Internationalen Tages der Geschwisterlichkeit aller Menschen sowie des fünften Jahrestages der Unterzeichnung des Abu-Dhabi-Dokuments erklärt der Vorsitzende der Unterkommission für den Interreligiösen Dialog der Deutschen Bischofsk
Weiterlesen →Telefon: +49 69 726491 // E-Mail:
info [at] cibedo [punkt] de
Copyright © 2020 Christlich-Islamischer Dialog - CIBEDO e. V. Alle Rechte vorbehalten.