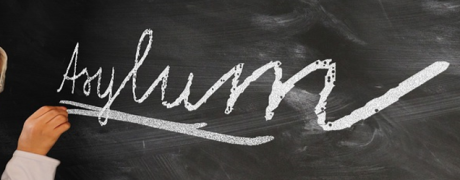Experten legen Abschlussbericht zu Muslimfeindlichkeit vor
29. Juni 2023
Comments are off
Anfeindungen bis in die Mitte der Bevölkerung Viele der 5,5 Millionen Muslime erleben hierzulande Hass und Ausgrenzung. Erstmals zeigt ein Bericht das Ausmaß; von Schule bis zu den Medien. Konsequenzen müssten folgen.Von Christoph Scholz (KNA) Berlin (KNA) In weiteren Teilen der deuts
Weiterlesen →Bundeskanzler gratuliert Muslimen zum Opferfest
28. Juni 2023
Comments are off
Berlin (KNA) Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Musliminnen und Muslimen „ein gesegnetes und friedliches Opferfest” gewünscht. „Es ist sicher für viele eine besondere Freude, dass erstmals seit der Pandemie die Pilgerfahrt nach Mekka wieder normal möglich ist. Frohes Fest!“, sc
Weiterlesen →UN würdigen Christen und Muslime in Afrika für Einsatz gegen HIV
27. Juni 2023
Comments are off
Genf/Johannesburg (KNA) Die Vereinten Nationen haben die Rolle christlicher und muslimischer Glaubensführer in Afrika im Kampf gegen HIV/Aids gewürdigt. Indem kirchliche und muslimische Einrichtungen Religion und bestmögliche Patientenversorgung auf wissenschaftlicher Basis verbänden,
Weiterlesen →Projekt des Berliner Mehrreligionenhauses kommt langsam voran
14. Juni 2023
Comments are off
Eigentlich sollten Juden, Christen und Muslime schon längst im Berliner „House of One“ unter einen Dach beten. Doch viele Probleme haben den Bau gebremst. Die Bauherren bleiben trotzdem zuversichtlich. Von Gregor Krumpholz (KNA) Berlin (KNA) Über zehn Jahre Planungen und noch immer ra
Weiterlesen →Renovabis begrüßt Friedensgipfel der Religionen in Slowenien
14. Juni 2023
Comments are off
Freising (KNA) Das katholische Osteuoropa-Hilfswerk Renovabis hat angesichts der aktuellen Spannungen im Kosovo den geplanten Friedensgipfel der Religionen begrüßt. Er soll am 17. Juni im slowenischen Koper stattfinden, wie das Hilfswerk am Mittwoch in Freising mitteilte. Renovabis-Ch
Weiterlesen →Kirchen und Verbände kritisieren EU-Einigung im Asylstreit
09. Juni 2023
Comments are off
Die EU-Innenminister haben sich nach langem Streit auf eine einheitliche Asylpolitik geeinigt, die auf eine Verschärfung hinausläuft. Aus den Kirchen kommt die Mahnung zur Wahrung der Menschenrechte.
Weiterlesen →Vertreter von interreligiösem Dialogzentrum beim Papst
07. Juni 2023
Comments are off
Papst Franziskus hat am Mittwoch den Generalsekretär des internationalen Dialogzentrums KAICIID empfangen, Zuhair Alharthi. Dieser habe bei der Begegnung für die Rolle des Vatikans bei der Gründung des König-Abdullah-Zentrums für interreligiösen und interkulturellen Dialog gedankt, te
Weiterlesen →Ausstellung in Osnabrück zeigt Moscheen-Vielfalt in Europa
06. Juni 2023
Comments are off
Osnabrück (KNA) Bilder europäischer Moscheen vieler Jahrhunderte zeigt seit Montagabend eine Fotoausstellung in der Volkshochschule Osnabrück. Von den maurischen Großbauten der Alhambra in Granada und Mezquita in Cordoba über moderne Architektur in Westeuropas Großstädten bis zu klein
Weiterlesen →Libanon will am 14. Juni neuen Präsidenten wählen
06. Juni 2023
Comments are off
Beirut (KNA) Der libanesische Parlamentspräsident Nabih Berri hat die 128 Abgeordneten für den 14. Juni zu einem erneuten Anlauf für die Wahl eines Staatspräsidenten einberufen. Die Staatsspitze ist seit dem Rücktritt des früheren Präsidenten Michel Aoun vakant. In den vergangenen Mon
Weiterlesen →Telefon: +49 69 726491 // E-Mail:
info [at] cibedo [punkt] de
Copyright © 2020 Christlich-Islamischer Dialog - CIBEDO e. V. Alle Rechte vorbehalten.