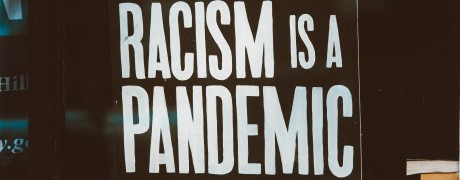Rund um den Ramadan
31. März 2022
Comments are off
“Euch ist vorgeschrieben zu fasten” Von Joachim Heinz (KNA) Bonn (KNA) Ab Samstag (2. April) wird ein guter Teil der knapp fünf Millionen Muslime in Deutschland rund vier Wochen lang fasten. Der Fastenmonat Ramadan dauert in diesem Jahr bis zum 2. Mai. Die Katholische Nach
Weiterlesen →Corona und Krieg überschatten Start des Fastenmonats Ramadan
31. März 2022
Comments are off
Bonn (KNA) Für die rund 1,9 Milliarden Muslime auf der Welt beginnt am Samstag der Ramadan. Zum dritten Mal in Folge findet der islamische Fastenmonat in vielen Ländern unter Corona-Bedingungen statt. Zahlreiche Treffen in der Gemeinschaft sowie gemeinsames Feiern seien weiterhin nur
Weiterlesen →Dubai will interreligiösen Dialog fördern
30. März 2022
Comments are off
Dubai (KNA) In Dubai ist erstmals eine Arbeitsgruppe zur Förderung des interreligiösen und interkulturellen Dialogs und zur Bekämpfung von religiöser Intoleranz und Hass zusammengetroffen. Die trilaterale Gruppe aus Vertretern der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), Israel und den U
Weiterlesen →Katholiken und Muslime betonen Verbundenheit – Maria als Symbol
29. März 2022
Comments are off
Köln (KNA) Beim Jahresempfang der Deutschen Bischofskonferenz für die Partner im christlich-islamischen Dialog haben Katholiken und Muslime ihre gegenseitige Verbundenheit betont. “Es ist von unschätzbarem Wert, wenn Christen und Muslime einander als Geschwister begegnen”,
Weiterlesen →CIBEDO-Beiträge 1/2022 – ist erschienen
26. März 2022
Comments are off
Liebe Leserinnen und Leser, „Krieg ist Wahnsinn“, sagte Papst Franziskus in Hinblick auf die hochgefährliche Situation in der Ukraine. Er führte weiter aus: „Ströme von Blut und Tränen fließen in der Ukraine. Es handelt sich nicht nur um eine Militäroperation, sondern um einen Krieg,
Weiterlesen →Dokumentationsstelle: Viel antimuslimischer Rassismus in Berlin
25. März 2022
Comments are off
Berlin (KNA) Bei “antimuslimischem Rassismus” gibt es in Berlin nach Einschätzung des “Netzwerks gegen Diskriminierung und Islamfeindlichkeit” weiterhin “eine gefährliche Entwicklung”. Zwar seien der Dokumentationsstelle des Netzwerks im vergangenen
Weiterlesen →Patriarch Rai lobt in Kairo Friedensbemühungen der Al-Azhar
22. März 2022
Comments are off
Kairo/Beirut (KNA) Mit einem Treffen mit dem Großimam der Kairoer Al-Azhar-Moschee, Scheich Mohammad Al-Tayyeb, hat der maronitische Patriarch Kardinal Bechara Rai am Montag seinen bis Mittwoch dauernden Ägypten-Besuch fortgesetzt. Der libanesische Kirchenführer würdigte dort “d
Weiterlesen →Benins Islam im Wandel
21. März 2022
Comments are off
Terroranschläge und Geld für Moscheen verändern den Norden. Die Gewalt aus Burkina Faso und Niger schwappt zunehmend nach Benin über. Priester wie Imame achten daher besonders auf Entwicklungen, die das Zusammenleben zwischen Christen und Muslimen beeinträchtigen könnten. Von Katrin G
Weiterlesen →Multireligiöses Treffen in Luxemburg
17. März 2022
Comments are off
Luxemburg/Potsdam (KNA) Zu einem Austausch über das Miteinander von Staat und Religion und über die Rolle von Religionen in gesellschaftspolitischen Debatten kommen 75 internationale Studierende in Luxemburg zusammen. An dem Treffen vom 23. bis 27. März nehmen jüdische, muslimische, c
Weiterlesen →Empfang für die Partner im christlich-islamischen Dialog, Einladung für Medienvertreter am 25. März 2022
16. März 2022
Comments are off
Die Deutsche Bischofskonferenz lädt zum dritten Mal zu einem Empfang für die Partner im christlich-islamischen Dialog ein. Die Kolleginnen und Kollegen der Medien sind herzlich zur Teilnahme eingeladen am Freitag, den 25. März 2022, in Köln. Nähere Informationen finden Sie hier
Weiterlesen →Telefon: +49 69 726491 // E-Mail:
info [at] cibedo [punkt] de
Copyright © 2020 Christlich-Islamischer Dialog - CIBEDO e. V. Alle Rechte vorbehalten.